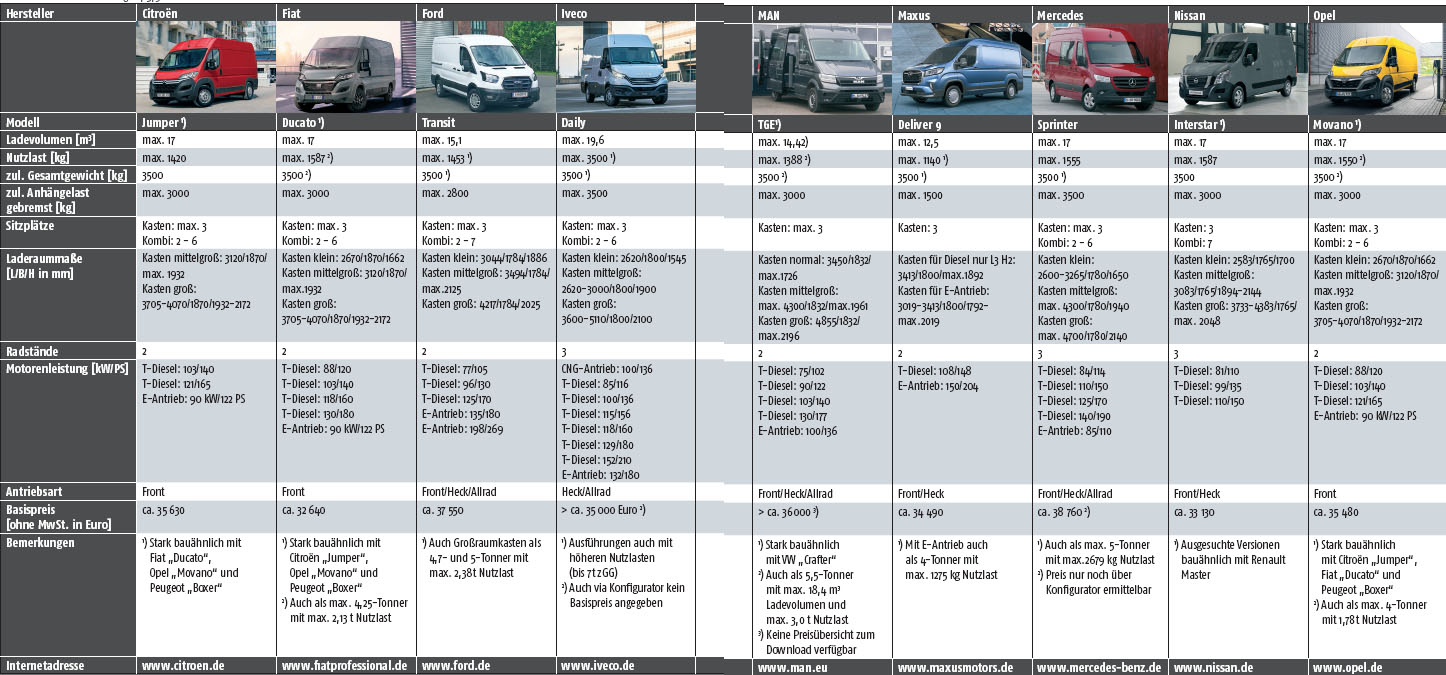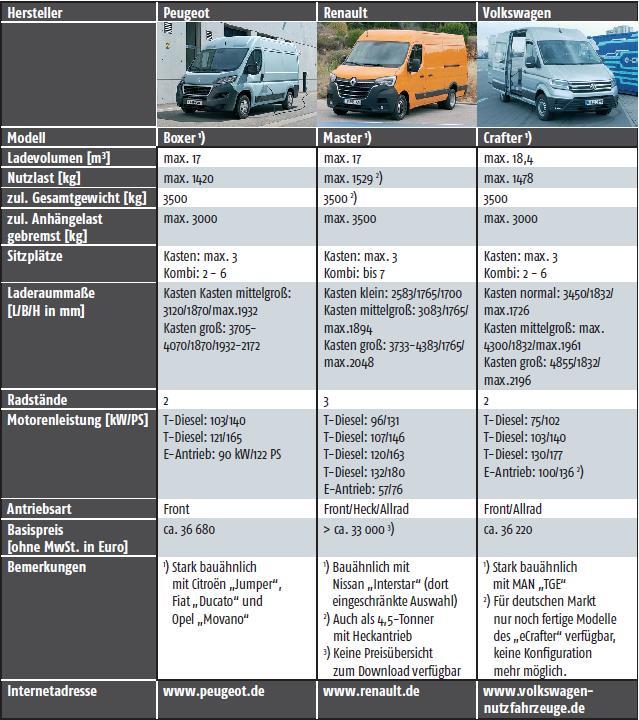Welcher Antrieb passt? [Seite 2 von 2]
Beim Transporter besteht die Wahl zwischen Verbrenner und E-Motor
Emissionen in verschärftem Rahmen
Seit Herbst 2021 ist für alle leichten Nutzfahrzeuge mit Verbrenner die Zulassung Euro 6d-ISC-FCM verbindlich geworden. Maximale NOx-Grenzwerte (Stickoxid) haben sich dabei nicht verschärft, doch mögliche Toleranzgrenzen sind jetzt noch enger gefasst als bei Euro 6d Temp – und die Einhaltung der Vorgaben während des Fahrbetriebes muss sich nun durch die gespeicherten Motordaten dokumentieren lassen. EU-Recht hat dies bereits vor Jahren festgelegt, sodass sich die Hersteller in der Weiterentwicklung der Motoren darauf einstellen konnten.
Hohen Stellenwert hat bekanntermaßen die CO2-Vermeidung (Kohlendioxid) bekommen. Doch festgelegte Einsparziele im Verkehrssektor sind bislang nicht annähernd verfolgt worden.
E-Antrieb beeinflusst Flottengrenzwert
Die EU hat den Automobilherstellern vorgegeben, dass sie nach dem Jahr 2021 die CO2-Emissionen ihrer Flotten weiter deutlich senken müssen. Um 15 % bis zum Jahr 2025 und um 37,5 % bis 2030, jeweils gemessen am schon ehrgeizigen Zielwert für 2021. Dann dürfen die Flotten jedes Herstellers im Schnitt pro Fahrzeug nur noch 95 g/km CO2 ausstoßen. Zum Vergleich: Ein Diesel im 3,5-Tonner, der jetzt aus der Fertigung rollt, emittiert gemäß WLTP meist weit mehr als 200 g/km CO2. Daraus lässt sich erklären, warum die Marken ein hohes Interesse daran haben, dass sich möglichst viele Käufer für einen E-Antrieb entscheiden, weil diese Antriebstechnik mit Null Emissionen in die Flottenwertung eingeht.
Die EU arbeitet an grundsätzlichen Richtlinien, die für fabrikneue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge ab dem Jahr 2035 nochmals verschärfte CO2-Grenzwerte vorsehen. Das könnte das Aus für neue Transporter mit Verbrennerantrieb herbeiführen und die E-Mobilität alternativlos machen – tatsächlich?
Helfen auf lange Sicht e-Fuels?
In der Diskussion bleiben weiterhin synthetische Kraft stoffe, sogenannte e-Fuels. Sie sind – nach aktuellem Stand – zwar nur durch großen regenerativen Energieaufwand herstellbar, doch weltweit könnten sie sowohl in neuen als auch in zig Millionen rollenden Altfahrzeugen eine drastische CO2-Minderung im Verkehrssektor bewirken.
In jedem Fall zeigt sich für den Entscheider im Fuhrpark, dass auch in den kommenden Jahren hohe Anforderungen an die Verbrennertechnik gestellt werden. Geringer Verbrauch und stark reduzierte Emissionen von CO2 und NOx sowie Feinstaub sind deshalb Kriterien, die bei der Fahrzeugwahl bedeutsam sind, eine hohe Umweltrelevanz haben und letztlich auch den Restwert eines Fahrzeugs mit bestimmen werden.
Front-, Heck- oder Allradantrieb
Vom Motor zum Antriebsstrang: War es lediglich der Ford „Transit“, der vor einigen Jahren als einziger Transporter die Option für Front-, Heck- und Allradantrieb anbot, so haben inzwischen etliche Mitbewerber gleichgezogen. Bei letzterer Variante muss man in punkto Geländetauglichkeit allerdings unterscheiden, ob es sich tatsächlich um eine vollwertige 4x4-Allradtechnik handelt oder lediglich um eine Viskokupplung oder nur um eine einfache Differenzialsperre, die das Durchdrehen eines Rades stoppt.
Ladevolumen liegt meist bei 10 m3
Bei aller Modellvielfalt, die bei den 3,5-Tonnern mit Verbrennerantrieb besteht, entscheiden sich die meisten Handwerksbetriebe für den mittleren Radstand bei mittelhohem Dach (Stehhöhe 190 cm). Dadurch stehen etwa 1,5 t Nutzlast und gut 10 m3 im Laderaum zur Verfügung.
Mit der Gesamtlänge von 6 m sowie einem Wendekreis von ca. 13,5 m kommen wohl die meisten Fahrer in der City klar. Übrigens: Meist besteht auch in dieser Karosseriegröße ein entsprechendes Angebot für einen alternativen E-Antrieb. Mögliche Maximalwerte, mit denen Hersteller bei Nutzlast oder Ladevolumen werben, sollten den Entscheider nicht verwirren. Die extra hohe Nutzlast eines Transporter modells mit knapp 2 t lässt sich beispielsweise nur durch eine Zwillingsbereifung oder einen kurzen Radstand in Kombination mit Frontantrieb und Normaldach erzielen. Wer sich jedoch für diese Variante entscheidet, hat sich die Option für Großvolumiges verbaut.
Wählt man das andere Extrem mit dem längsten Radstand plus Überhang und dem höchsten Dach, können zwar beeindruckende 19 m3 zur Verfügung stehen, dann aber vielleicht nicht mal 1000 kg Nutzlast. Hinzu kommt das Handikap, dafür den nötigen Stellplatz finden zu müssen.
Wände und Boden im Frachtraum schützen
Die Basisausstattung im Frachtraum ist meist unzureichend. Bei einigen Modellen findet der Handwerker ein ungeschütztes Bodenblech vor, spärliche Verkleidungen bis zur halben Seitenhöhe und Verzurrösen nur in Bodennähe. Doch bedarf es eines vollflächigen Schutzes von Wände und Boden, damit kein verbeultes Blech den Wiederverkaufswert mindert. Auch müssen Verzurrleisten für Gurte und/oder Spannstangen im mittleren und oberen Frachtraumbereich vorhanden sein, die sicheren Halt bieten.
Etliche Marken führen solche Ausstattungen in Kombination mit Verkleidungen aus Sperrholz oder Verbundwerkstoff wenigstens auf der Liste der Optionen – meist zu einem beeindruckenden Aufpreis. Passend zugeschnittene Teile für die verschiedensten Fahrzeugtypen lassen sich aber auch selbst ordern und montieren.
Sichere Schiebetüren rasten ein
Bei den 3,5-Tonnern sind seitliche Schiebetüren meist so gesichert, dass sie voll geöffnet einrasten und sich nicht unbeabsichtigt in Bewegung setzen. Hecktüren lassen sich optional so ausstatten, dass sie über den Schwenkbereich von 180 Grad hinaus zu öffnen sind. Das erleichtert das Laden an einer Rampe oder wird nicht zum Hindernis neben einem Gehsteig oder Fahrradweg.
Die Trennwand ist beim Kastenwagen obligatorisch, muss aber nicht unmittelbar hinter Fahrer und Beifahrer positioniert sein. Etliche Marken bieten integrierte Doppelkabinen. Meist in Kombination mit einem langen Radstand gibt es dann eine zweite Sitzreihe mit drei oder vier Plätzen. Dies kann eine herausnehmbare Bank sein, es gibt aber auch komplette Einheiten von Sitzplätzen samt Trennwand aus Kunststoff. Gemessen an komfortablen, verstellbaren Einzelsitzen für Fahrer und Beifahrer hat die zweite Sitzreihe allerdings eher den Komfort einer Mitfahrgelegenheit.
Komfort im Cockpit
An seinem Arbeitsplatz hinter dem Lenkrad muss der Transporterfahrer kaum auf etwas verzichten, was optional auch im Pkw den Komfort steigert. Beim Interieur sind es mindestens zwei unterschiedlich wertige Ausstattungslinien. Deutlich zugelegt haben neukonzipierte Instrumententräger, die nicht nur Tachometer oder Bordcomputer integrieren, sondern darüber hinaus auf Wunsch Navigation, Multimediasysteme und Konnektivität bieten.
Autor: Thomas Dietrich, freier Journalist
- 1
- 2