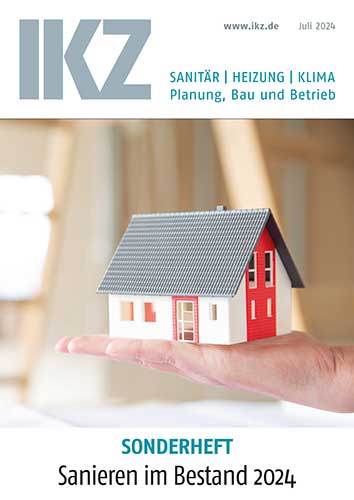Wieder auf den Zahn gefühlt
Studie Stromspeicher-Inspektion 2025 untersucht erstmals auch Energiemanagementsysteme
Mit der Stromspeicher-Inspektion der Hochschule für Technik und Wissenschaft Berlin (HTW Berlin) hält man nach derzeitigem Wissensstand nach wie vor den praktisch einzigen Vergleichsleitfaden auf wissenschaftlicher Basis für Solarstromspeicher in der Hand. In der neuen Ausgabe 2025, die im Februar erschienen ist, bewerten die Experten neben dem Bewährten zum ersten Mal auch die Qualität prognosebasierter Energiemanagementsysteme (EMS) verschiedener Anbieter, die sich einem Vergleich stellten. Diesen Part untersuchte die HTW gemeinsam mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT).
Bereits seit 2018 legen die Berliner Forscher jährlich ihre Studie Stromspeicher-Inspektion vor. Alle Ausgaben gibt es zum kostenlosen Download unter solar.htw-berlin.de/studien. In der neuesten Ausgabe 2025 wurde dieses Mal die Energieeffizienz von 22 Stromspeichersystemen (17 Hersteller) unter die Lupe genommen. Die Prüfer bewerten traditionell die Energieeffizienz der Geräte in den zwei Leistungsklassen 5 kW und 10 kW. 10 Systeme erreichten die höchste Effizienzklasse A. Die Bewertungsergebnisse bestätigen laut HTW die herausragende Systemeffizienz vor allem der europäischen Wechselrichterhersteller. Neben den europäischen Anbietern sind lediglich die chinesischen Hersteller „Good-We“ und „Fox ESS“ in diesem Jahr unter den Spitzenreitern vertreten.
Die Testsieger/Top 3
Als Testsieger der aktuellen Stromspeicher-Inspektion 2025 mit dem höchsten System Performance Index (SPI) in den Leistungsklassen 5 kW und 10 kW gehen die PV-Speichersysteme von RCT Power hervor. Die folgenden Plätze werden von Fronius und Kostal (in der 5-kW-Klasse) sowie in der 10-kW-Klasse von Energy Depot und Fronius belegt. Der SPI ist eine von der HTW entwickelte Kennzahl, die zur Bewertung und zum Vergleich der Energieeffizienz von PV-Speichersystemen dient, indem das Betriebsverhalten einer Anlage über den Zeitraum von einem Jahr simuliert wird. Wie der SPI konkret berechnet wird und welche Größen darin einfließen, ist in der ersten HTW-Speicherinspektion 2018 beschrieben.
Multi-Level-Technologie lässt aufhorchen
Erstmals in einer Inspektion wurde auch ein Batteriesystem mit der Multi-Level-Technologie untersucht, und der Kandidat, das Batteriesystem „SAX Power Home Plus“, knackte gleich die 98-%-Hürde beim mittleren Wirkungsgrad im Entladebetrieb. Was das System von üblichen Batterie- und Hybridwechselrichtern unterscheidet, erläutern die Autoren so: „Jeder Batteriezellstrang ist mit einem eigenen Leistungsschalter ausgestattet. Die 24 im Gerät verbauten Batteriezellstränge können dadurch individuell im Bruchteil einer Sekunde zuund abgeschaltet werden. Am Ausgang des Batteriesystems überlagern sich die Spannungen der aktivierten Zellstränge zu einer sinusförmigen Wechselspannung. Gegenüber herkömmlichen Wechselrichtern ermöglicht das Multi-Level-Konzept geringere Umwandlungsverluste im Lade- und Entladebetrieb. Über den gesamten Arbeitsbereich erzielt das AC-gekoppelte Batteriesystem SAX Power Home Plus die höchsten bisher in der Stromspeicher-Inspektion ermittelten Wirkungsgrade.“
Datenblätter und die Realität
Eine nicht unbedingt neue Baustelle wird auch in der Inspektion behandelt, weil sie wichtig ist: Die HTW-Forscher fordern von der Solar- und Stromspeicherbranche verlässlichere Datenblattangaben. „Die Angaben der Hersteller zum Energieinhalt der Batteriespeicher sind in zwei Drittel der untersuchten Fälle zu optimistisch. Die im Teillastbetrieb ermittelten Wirkungsgrade sind im Vergleich zu den maximalen Wirkungsgradangaben der Hersteller auf den Datenblättern deutlich geringer. Die Angaben suggerieren geringe Verluste, die im Betrieb jedoch selten erreicht werden“, resümieren sie. In Datenblättern seien in der Regel nur die maximalen Wirkungsgrade der Wechselrichter zu finden. Diese Werte bestimmen die Hersteller in unterschiedlichen Betriebspunkten unter idealen Prüfbedingungen. Die Inspektion zeigt auch auf, wie stark die Wirkungsgradangaben der Hersteller von den Labormesswerten abweichen.
Warum man laut HTW Berlin auf hohe Teillastwirkungsgrade achten sollte: Heimspeicher werden vorwiegend in der Nacht mit Leistungen zwischen 100 W und 300 W entladen. „Je effizienter der Wechselrichter im Entladebetrieb bei diesen geringen Leistungen im sogenannten Teillastbetrieb ist, desto später ist der Batteriespeicher nachts entladen, der Strombezug aus dem Netz fällt geringer aus und der Batteriespeicher kann kleiner dimensioniert werden, da weniger Umwandlungsverluste auftreten.“ Vor allem Haushalte mit einem geringen nächtlichen Stromverbrauch sollten daher bei der Wahl des Wechselrichters auf hohe Teillastwirkungsgrade achten, raten die Autoren. Auch die Angaben der Hersteller zum Energieinhalt der Batteriespeicher sind laut Inspektion in zwei Drittel der untersuchten Fälle zu optimistisch. Bei vier Geräten lag die im Labor ermittelte nutzbare Speicherkapazität sogar um mehr als 6 Prozentpunkte unter dem Datenblattwert.
Neu entwickelter EMS-Test
HTW Berlin und KIT bewerten mit dem neu entwickelten Energiemanagement-Test auch die Qualität der PV-Spitzenkappung durch Batteriesysteme. Ergebnis: Das prognosebasierte Energiemanagement (EMS) der sechs getesteten Hersteller (Fenecon, Kostal, Sonnen, RCT Power sowie zwei anonym teilnehmende Hersteller) steigert den Solarstromertrag um 4 bis 10 Prozentpunkte. Ein weiteres interessantes Ergebnis: Prognosebasierte Ladestrategien verlängern die Batterielebensdauer. Während des Testzeitraums halbierte die intelligente Ladestrategie eines Herstellers die Verweildauer des Batteriespeichers bei Ladezuständen oberhalb von 90 %.
Prognosebasierte Ladestrategie
Wie funktioniert überhaupt eine prognosebasierte Ladestrategie bzw. wie ist sie angelegt? Im Kern geht es um die Prognosen der Erzeugung und der elektrischen Last sowie der daraus resultierenden optimalen Einspeicherung von Strom in den Speicher mit dem Ziel, möglichst wenig Strom zu „verschenken“ und vor diesem Hintergrund die Netz-Einspeisung also zu optimieren sowie im Umkehrschluss den Netzbezug von Fremdstrom zu minimieren (über die Abdrosselung, siehe auch Beitrag „Die Netze weniger verstopfen“ in IKZ 5/25). Die HTW erläutert, wie das in der Praxis angegangen wird, so: „Die Batterieladeoptimierung lässt sich mathematisch zum Beispiel durch einen linearen Optimierungsalgorithmus beschreiben. Der Algorithmus ermittelt hierzu in jedem Zeitschritt des Prognosezeitraums die optimale Ladeleistung. Da Abweichungen zwischen den Prognosewerten und realen Messwerten unvermeidbar sind, korrigiert häufig eine nachgelagerte Regelung die für den aktuellen Zeitpunkt ermittelte Batterieladeleistung.“
Die Batterie-Hersteller, die sich dem Vergleichstest gestellt haben, verfolgen zum Zweck des Ziels unterschiedliche Herangehensweisen, die sich z. B. in der zeitlichen Taktung der Aktualisierungen/Überprüfungen unterscheiden oder auch, woher sie die notwendigen Lerndaten beziehen, z. B. über Wetterprognosen aus dem Internet oder systeminterne Daten. Die Hersteller lassen sich diesbezüglich aber auch nicht (zu) tief in die Karten schauen.
Die Systeme laden zwar unterschiedlich, auch aufgrund der zugrundeliegenden Ladephilosophien, was zu verschiedenen Ergebnissen führt, hinsichtlich vermiedener Abregelungsverlusten und auch von Ladezuständen. Generell aber ist das Ergebnis, dass prognosebasierte EMS sehr viel besser – man kann auch sagen: intelligenter – Solarstromproduktion, Einspeisung und Speicherung in Einklang bringen, als im Fall, wenn man darauf verzichtet. Die Beladung der Speicher ist über den Tag verteilt gleichmäßiger und angepasster an den Solarertrag.
Zum zweiten Ergebnis, der verzögerten Alterung von Speichersystemen Dank prognosebasierter EMS. Hintergrund: Es gibt die Unterscheidung zwischen zyklischer Batteriealterung (Laden/Entladen) und der kalendarischen Alterung, die vor allem dann beschleunigt wird, wenn eine Batterie oft und viel Zeit „voll“ ist. Bei Heimspeichern ist in den meisten Fällen die kalendarische Lebensdauer der limitierende Faktor, nicht die zyklische, sagt Dr.-Ing. Georg Angenendt von der CTO Accure Battery Intelligence GmbH. Nina Munzke, Gruppenleiterin am mit an der Inspektion involviertem KIT, folgert daraus: „Je kürzer der Zeitraum ist, in dem der Batteriespeicher vollständig geladen ist, desto langsamer altert er. Um eine möglichst lange Nutzungsdauer des Batteriespeichers zu erreichen, sollte er an sonnigen Tagen nicht frühmorgens, sondern erst in den Mittagsund Nachmittagsstunden laden.“
Ein zusammenfassendes Resümee
Die Autoren der Stromspeicher-Inspektion 2025 fassen die Eigenschaft en eines sehr guten Energiemanagements für Stromspeicher am Ende wie folgt zusammen:
- An sonnigen Tagen sollte der Batteriespeicher nicht frühmorgens, sondern erst später beginnen zu laden;
- Stattdessen sollte er mittags laden, um die Solarstromspitze zu kappen;
- Erst nachmittags sollte er seinen maximalen Ladezustand erreichen;
- Er sollte nur für kurze Zeit bei hohen Ladezuständen verweilen, damit er langsamer altert;
- Er sollte regelmäßig vom Energiemanager einen aktualisierten Ladefahrplan erhalten;
- Er sollte schnell auf kurzfristige Änderungen der Erzeugung und des Verbrauchs reagieren;
- Und er sollte dem prognosebasierten Energiemanagement den genauen Ladezustand bereitstellen.
Autor: Dittmar Koop