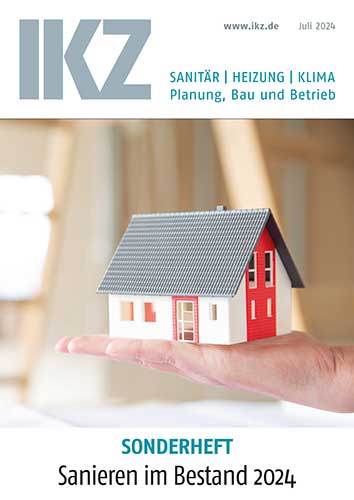So stellt Hansa seine Armaturen fürs Bad her
Das Herz aller Hansa-Armaturen ist Langlebigkeit. Aber wie genau werden sie hergestellt? Das wird hier Schritt für Schritt beschrieben und gezeigt.
Seit vielen Monaten ist häufiges Händewaschen als einfache und gleichzeitig äußerst wirkungsvolle Hygienemaßnahme in den Fokus gerückt. Was für die menschliche Gesundheit ein Gewinn ist, stellt für Armaturen eine große Beanspruchung dar. Die Basis für eine hochfrequente Nutzung ist die Langlebigkeit aller Komponenten. Hochwertiges Material, Handwerkskunst und umfangreiche Prüfungen machen einen entscheidenden Unterschied. Von der Idee zum Versand erläutern wir nachfolgend die Etappen des Herstellungsprozesses am Beispiel einer Armatur der Hansa Armaturen GmbH.
Am Anfang steht das Design
Jede Armatur von Hansa hat ihren Ursprung in wenigen Linien in den Programmen der Produktdesigner. Wie Rohdiamanten werden diese ersten Ideen über verschiedene Entwurfsstadien zu einem ausgereiften Design weiterentwickelt. Ist dieses Produktdesign schließlich freigegeben, werden daraus Prototypen hergestellt und die Fertigung beginnt.
Produktionsschritte für eine Armatur:
- Bau des Innenteils
- Gießen
- Sägen
- Mechanische Bearbeitung
- Abschleifen
- Polieren
- Verchromen
- Montieren
- Testen
Bau des Innenteils
Der Begriff „Innenteil“ bezieht sich hier auf die Wasserleitungen, den Hohlraum innerhalb der Armatur. Dieser Hohlraum, durch den später das Wasser fließen wird, muss beim Gießen ausgefüllt werden. Hierfür verwendet man einen sogenannten Sandkern, der wie in einem Ofen gebacken wird. Dieses Verfahren nennt man Kernschießen (Bild 1).
Gießen
Messing ist ein wichtiger Bestandteil von Armaturen (Bild 2). Dabei ist die Qualität der verwendeten Legierung ausschlaggebend für die Eigenschaften des Produktes. Entscheidend für die Armatur ist ihre Entzinkungsbeständigkeit. Denn sie muss den unterschiedlichen Trinkwasser-Qualitäten zuverlässig Paroli bieten – unabhängig von der Art ihrer Verwendung.
Das Gießen der Hansa-Armaturengehäuse erfolgt daher mit einer speziellen entzinkungsarmen Messinglegierungen. Die Maskenformen werden in Wasser und in eine Grafitlösung getaucht, wobei ein Arbeiter — der sogenannte „Gießer“ — das Innenteil in die Gussform einsetzt, nachdem er sämtlichen losen Sand und Schmutz entfernt hat.
Die Gussformen werden geschlossen und in einen lodernden Gießofen gestellt. In diesem befinden sich etwa drei Tonnen geschmolzenes Messing. Die Gussform wird von unten mit der notwenigen Menge an flüssigem Messing gefüllt (Bild 3), bis dieses an der Oberseite der Form austritt und dem Gießer anzeigt, dass die Form vollständig gefüllt ist.
Während das Messing erkaltet, zerfällt der Sandkern zu losem Sand. So kann er problemlos wieder entfernt werden. Damit keinerlei Sandrückstände bleiben, werden diese in einer Art Zentrifuge abschließend aus der Armatur herausgeschleudert.
Sägen
Da üblicherweise immer zwei Armaturenkörper pro Guss entstehen, werden die abgekühlten Armaturengehäuse (Bild 4) nach dem Gießvorgang auseinandergesägt. Dabei werden auch überschüssige Teile, die nicht zum Formteil gehören (zum Beispiel der Anguss), abgesägt.
Mechanische Bearbeitung, Abschleifen und Polieren
Auf einem Förderband durchlaufen die Armaturenkörper automatisierte Bearbeitungs-, Schleif- und Polierprozesse. Das Ziel: eine makellos glatte Oberfläche. Jede Armatur wird anschließend von Hand überprüft, um sicherzustellen, dass sie den höchsten Standards gerecht wird – dabei werden kleinere Makel manuell behoben (Bilder 5 und 6).
Verchromen
Der letzte Schritt der Fertigung besteht in der Verchromung (Bild 7). Sie verleiht jeder Armatur eine harte, glänzende und verschleißfeste Oberfläche. Ein Schritt, der laut Hansa-Vertriebsleiter Thomas Musial besondere Sorgfalt erfordert: „Vor der Verchromung der Produkte müssen die Oberflächen makellos sein, da Chrom Unreinheiten auf den Armaturen noch hervorhebt. Selbst kleinste Verunreinigungen würden nach der Verchromung Probleme verursachen.“ Daher muss sichergestellt werden, dass die Armaturen nicht mit bloßen Händen angefasst werden, damit auf der Oberfläche keine Fingerabdrücke sichtbar sind.
Obwohl alle sichtbaren Teile verchromt werden, bestehen Armaturen nicht nur aus Messing, sondern auch aus Kunststoff- und Verbundbauteilen. Arbeiten an Kunststoffteilen stellen die weitaus größere Herausforderung dar: Sie werden zuerst mit einer Kupfer- und dann mit einer Nickelbeschichtung versehen, um die Oberflächen vor Wärmeausdehnung zu schützen. Zum Schluss werden sie verchromt — das dauert ungefähr zwei Stunden. Dabei wird die Armatur bis zu 40 Mal in verschiedene Bäder getaucht. Nach der Verchromung werden Markierungen wie zum Beispiel das Markenlogo mit Lasertechnik eingraviert. Anschließend wird die Armaturen fertig montiert (Bild 8).
Prüfung
Zur Sicherung der Qualität erfolgt zum Abschluss des Produktionsprozesses eine Stichproben-Kontrolle. Hier werden verschiedene Parameter überprüft — beispielsweise der einwandfreie Zustand im Hinblick auf Optik und Funktionalität. Ein Großteil der täglichen Armaturen-Produktion wird so eingehend kontrolliert. Alle unsere Armaturen werden zusätzlich auf Dichtheit überprüft.
Raumschall- und Rohrschallprüfung
Das Werk Rauma in Finnland überprüft die Armaturen auf ihren Raumschall hin. Die Armatur wird in einer auf Federn gelagerten und schallentkoppelten Kabine komplett installiert, inklusive Wasseranschluss und Wasserdurchfluss. Ein Mikrofon rotiert durch diese Kabine, nimmt den Schall der jeweils laufenden Armatur auf und übermittelt die Lautstärke des Schalls. Dieser Geräuschpegel darf 20 Dezibel nicht überschreiten. Dies entspricht den Anforderungen an die Geräuschklasse 1. In Stuttgart erfolgt bereits in der Entwicklungsphase eine sogenannte Rohrschallprüfung. Hier messen Drucksensoren, die am Rohr montiert werden, den Schallwert bei Wasserdurchfluss. Auch dieser darf die Geräuschklasse 1 nicht überschreiten.
Danach sind die Armaturen fertig für die Verpackung und den Versand an ihren endgültigen Bestimmungsort – in Privathäusern, Krankenhäusern, Schulen und vielen anderen Gebäuden weltweit.