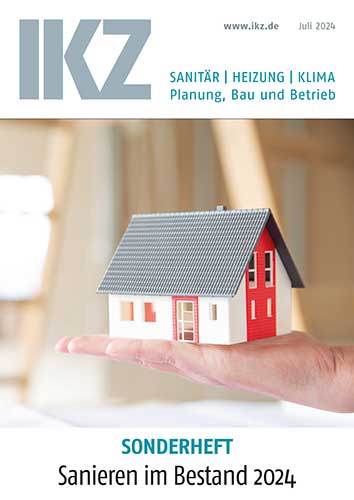Ready in der Warteschleife
Brennwert bleibt das, was es zu Wasserstoff sagt: ready
Heizen mit Wasserstoff statt mit Erdgas? Wie realistisch ist das? Was muss man dem Heizungs-Kunden als SHKler ehrlicherweise sagen, wenn er danach fragt: Technisch ist das machbar, doch nutzbar ist es noch nicht. Wasserstoff-Heizungen befinden sich eben aktuell nur im Startblock, weil es dafür am Markt abgesehen von einzelnen Pilotprojekten keinen Brennstoff gibt und dieser auch erkennbar nicht absehbar ist.
Viele Gas-Brennwertkessel sind „H2ready“. Und ja, es gibt auch verschiedene Logos dazu, z. B. von Seiten des BDH oder auch von Unternehmensseite. Heutige Erdgas-Brennwertgeräte vertragen bereits einen gewissen Prozentsatz Wasserstoff in Form von Beimischungen zum Erdgas. Eine hundertprozentige Umstellung solcher Geräte ist dann aber mit Anpassungen der Verbrennungstechnik verbunden. Wasserstoff (H2) hat z. B. einen anderen Brennwert als Erdgas, eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit und eine höhere Flammentemperatur (ca. 2130 °C bei H2 und 1960 °C bei Erdgas). Der Heizwert von Wasserstoff hingegen ist wesentlich geringer als der von Erdgas (3 kWh/m3 zu 10 kWh/m3), man benötigt also das 3-fache Volumen im Vergleich zu Erdgas. Technisch machbar ist das schon längst, wie verschiedene Feldversuche und Pilotprojekte in der Vergangenheit zeigten.
Lösungen lagen/liegen vor
Heizungshersteller Remeha beispiels-weise, der nach eigenen Angaben als einer der ersten in die Thematik Wasserstoffkessel eingestiegen war, ist erstmal ausgestiegen. „Es gab lediglich Pilotprojekte und der Wasserstoffkessel ist nie in die Serienreife gegangen. Aktuell verfolgen wir das Thema gar nicht mehr, weil wir nicht davon ausgehen, dass Wasserstoff in der Wärmeproduktion eine Rolle spielen wird“, antwortet das Unternehmen auf Nachfrage.
Buderus hat auf der diesjährigen ISH seinen neuen, hybridfähigen Gas-Brennwertkessel „Logamax plus GBH172i“ vorgestellt. Das „Wärmepumpen-Hybridgerät“ lässt sich sowohl als eigenständiges Gas-Brennwertgerät oder in Kombination mit einer Wärmepumpen-Außeneinheit betreiben. Auch eine Umrüstung auf eine monoenergetische Wärmepumpe ist möglich. „Das Gerät ist H2ready und könnte künftig mit bis zu 100 % Wasserstoff arbeiten“, sagt Buderus. Die Umrüstsets sollen allerdings erst in vier Jahren verfügbar sein. Das mag sich noch nach „lange hin“ anhören, bei genauerer Betrachtung ist es das aber nicht. Denn ein Blick auf den Stand rückt Wasserstoff nennenswert ins nächste Jahrzehnt.
Ein paar einordnende Zahlen
Die Nationale Wasserstoffstrategie (NWS) der Bundesregierung aus dem Jahr 2020 und ihre Fortschreibung aus dem Jahr 2023 sehen das Ziel für die heimische Elektrolysekapazität in 2030 von 5 Gigawatt (GW, Aussage der NWS 2020 noch) auf mindestens 10 GW (Fortschreibung 2023) erhöht. Der restliche Bedarf solle durch Importe gedeckt werden, dafür sei eine gesonderte Importstrategie zu entwickeln. Hört sich nach viel an, ist es aber nicht. Dazu ein paar Zahlen: Der Endenergiebedarf im deutschen Verkehrssektor beläuft sich laut aktuellen Zahlen des Umweltbundesamts (UBA) für das Jahr 2023 auf 698 Terrawattstunden (TWh). Die Industrie schlug mit 624 TWh zu Buche, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen mit 314 TWh. Der Endenergiebedarf im deutschen Wärmesektor (Raumwärme und Warmwasser, Kälte) summiert sich auf 632 TWh. Selbst wenn die von der Bundesregierung angepeilten 10 GW Elektrolysekapazität auf 100 % Volllaststunden (VLh) kämen (100 % VLh = 8760 h = Zahl der Stunden im Jahr bei 365 Tagen), dann könnten sie theoretisch rund 88 TWh produzieren. Allerdings ist dabei nicht der Anlagen-Wirkungsgrad berücksichtigt, der nirgendwo, wie hier einmal angenommen, 100 % beträgt. Aber es soll grob einfach nur die Verhältnisse und Potenziale des Wasserstoffs aufzeigen, worüber zu sprechen ist. Zum Beispiel auch über den Preis.
Prognostizierte H2-Preise
Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK), der im Ausbau der Wasserstoffnutzung eine unbedingte Notwendigkeit sieht, („Ohne Wasserstoff dürften die ambitionierten Klimaziele Deutschlands und Europas kaum erreichbar sein.“) fasst Aussagen einer Studie des Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln (EWI) wie folgt zusammen:
- „Preise für grünen Wasserstoff von 2 Euro (Ausland) bis 3 Euro/kg (Deutschland) in 2030 sind möglich. Das entspricht rund 7 bis 10 ct/kWh.“
In der Reihe derer, die davon dann als erste profitieren könnten, steht der Wärmemarkt nicht, sondern die Industrie. Die große Vision ist, hierfür das vorhandene Erdgasnetz zu nutzen, das dann statt Erdgas grünen Wasserstoff transportiert. Experten gehen davon aus, dass es vor dem großen Wurf zunächst Insellösungen geben wird, also kleine Erdgas-Verteilnetze, die auf Wasserstoff umgestellt werden. Auch hier ist allerdings die Frage, wer davon in der Rangfolge zunächst den Nutzen hat. Viel deutet darauf hin, dass es die Industrie sein wird. Bis 2027/2028 soll z. B. über die IPCEI-Förderung ein Wasserstoffstartnetz mit mehr als 1800 km umgestellten und neu gebauten Wasserstoffleitungen in Deutschland aufgebaut werden. IP-2025CEI (Abkürzung für „Important Projects of Common European Interest“/„Wichtige Projekte von gemeinsamem europäischem Interesse“), ist ein Förderprogramm der EU. Dieses hat z. B. auch das aktuelle Hamburger Wasserstoff-Industrie-Leitungsnetz „HH-Win“ mitgefördert beim Bau der ersten 40 km. Insgesamt sind 60 km Leitungslänge geplant.
Noch nicht in Sicht
Dass Erdgas-Brennwertkessel heute auf dem Markt vermehrt mit „H2ready“ vermarktet werden, ist Ausdruck von technischer Realität, also Machbarkeit und natürlich auch Marketing. Man sollte realistisch im Kundengespräch aber kommunizieren, was hier in den nächsten Jahren geht. Wasserstoffkompatible Brennwertgeräte können eben nur mit Wasserstoff betrieben werden, wenn es diesen gibt. Zu Heizzwecken ist der jedenfalls noch nicht in Sicht.
„Farben“ des Wasserstoffs
Obwohl Wasserstoff an sich, chemisch gesehen, ein farbloser Stoff ist, hat er doch „Farben“. Welche hängt davon ab, wieviel CO2-Emissionen mit seiner Herstellung verbunden sind. Am unteren Ende der Skala ist er grau. Dieser wird entweder per Wasserelektrolyse oder durch die Reformierung von Erdgas mittels fossiler Energieträger gewonnen wird. Klassisch fallen darunter die Wasserstoffe des Hüttenwesens und der Chemieindustrie.
Blauer Wasserstoff ist eine Stufe höher angesiedelt und seit einiger Zeit vermehrt in den Medien. Er bezeichnet einen Wasserstoff, der durch die Reformierung von Erdgas gewonnen wird. Das dabei abgeschiedene Kohlendioxid soll unterirdisch eingelagert werden – Carbon Capture and Storage (CCS). CCS ist allerdings sehr umstritten, weil die Langzeitfolgen und die möglichen Umweltauswirkungen überhaupt nicht abgeschätzt werden können.
Türkiser Wasserstoff befindet sich in der Farbskala an der Übergangsgrenze von blauem zu grünem Wasserstoff. Bei türkisem Wasserstoff wird Methan mit Hilfe von Pyrolyse in Wasserstoff und festen Kohlenstoff zerlegt. Auch hier ist die Quelle in der Hauptsache Erdgas. Denkbar wären allerdings auch andere Methan-Quellen, z. B. Biogas, jedoch ist die zur Verfügung stehende Menge begrenzt. Der Kohlenstoff lässt sich ggf. nutzen. Grüner Wasserstoff ist nach derzeitiger Definition der, welcher per Wasserelektrolyse und unter Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energien entsteht. Nur grüner Wasserstoff machte konsequenter Weise am Ende Sinn, wenn es um die Dekarbonisierung des Wärmesektors mit Hilfe von Wasserstoff gehen soll. (DK)
Autor: Dittmar Koop