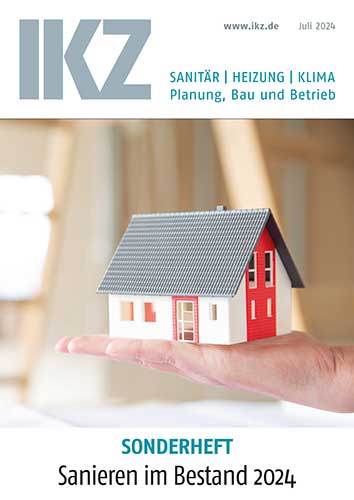Green-Hospital-Konzept erfolgreich umgesetzt
Varisano Klinik Frankfurt im Passivhausstandard
Gesundheitseinrichtungen müssen zur Sicherung einer hochwertigen medizinischen Versorgung ein multiples Leistungsspektrum erfüllen und dabei nicht nur ökonomische, sondern zunehmend auch ökosoziale Aspekte im Blick behalten. In vielen deutschen Krankenhäusern und Kliniken wird die grüne Transformation derzeit mit Nachdruck vorangetrieben. Dabei sind die Strategien und Maßnahmen eines aktiven Strukturwandels vielfältig. In Frankfurt am Main präsentierte der kommunale Gesundheitsverbund varisano im vergangenen Jahr ein Umweltkonzept, das in der Branche Schule machen soll: Die Umsetzung des Passivhaus-Standards im Hochenergiebetrieb eines Maximalversorger-Krankenhauses.
In der medizinischen Versorgung hat das Energiemanagement eine übergeordnete Funktion: Auf der Kälteseite müssen zahlreiche kritische Prozesse, etwa die Kühlung von lebenserhaltenden Geräten, die exakte Temperierung von Operationssälen und Intensivstationen oder die Wärmeableitung aus den Serverräumen reguliert und stabilisiert werden. Parallel dazu sind im Bereich der Wärmeversorgung spezifische Temperaturniveaus zwingend einzuhalten – etwa bei der Raumklimatisierung und der Warmwasserbereitstellung. In allen Anwendungsgebieten haben thermische Präzision und lückenlose Ausfallsicherheit oberste Priorität.
Wie sich Umweltorientierung, Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen sowie Rentabilitätsziele im Klinikbetrieb zusammenführen lassen, zeigt ein Pilotprojekt, das Anfang 2023 im Frankfurter Stadtteil Höchst präsentiert wurde: Weltweit erstmalig öffnete mit dem varisano-Neubau ein vom Passivhaus-Institut Darmstadt geplantes und zertifiziertes Krankenhaus die Pforten. Vorausgegangen war eine Grundlagenstudie im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV), in deren Rahmen die Voraussetzungen für die Umsetzung des Passivhaus-Standards in Krankenhäusern untersucht wurde. Dabei gingen die Forscher der Frage nach, ob und auf welche Weise sich eine signifikante Bedarfsreduzierung aller Energieanwendungen in einem Gebäude erzielen lässt, ohne dabei Komforteinbußen zu verursachen. Als wichtigster Hebel für die maximale Effizienzausschöpfung identifizierten sie das konsequente Vermeiden von Energieverlusten.
Ein Leuchtturmkonzept – nicht nur für das Gesundheitswesen
Der Passivhaus-Standard basiert auf verschiedenen bau- und betriebsseitigen Faktoren, die für eine energetische Verbrauchsabsenkung ineinandergreifen müssen. Hierzu zählt eine gut gedämmte, wärmebrückenfreie Gebäudehülle mit einem besonders niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) der beheizten Gebäudebereiche. Daneben leisten die Reduzierung der Kühllasten und die Anwendung passiver Kühlstrategien (u. a. freie Kühlung und Verdunstungskühlung) einen entscheidenden Beitrag zur Verringerung des kältebezogenen Energie-Inputs. Im neuen Gebäude der varisano Klinik in Frankfurt Höchst erfolgt die Kälteerzeugung durch Einsatz eines Rückkühlers und einer Kältemaschine, die im Freikühlbetrieb (300 kW) mit einem Thermosiphon arbeiten. Eine weitere zentrale Rolle in der Energieversorgung und zur Sicherung der Komfortqualität spielt das Lüft ungsmanagement: Sowohl der eingesetzte Technologietyp als auch die Anlagenpositionierung und die Lüft ungsplanung/-regelung sind in Räumen mit hoher Frequentierung und langen Nutzungszeiten essenziell.
Für die Erzeugung von Strom und Wärme kommt ein Kraft -Wärme-Kopplungs-Verfahren zum Einsatz: Eine erdgasbetriebene Brennstoff zelle produziert eine Leistung von 100 kWel. Der Wärmebedarf des Krankenhauses liegt bei rund 1300 kW für die Gebäudeheizung und 200 kW für die Bereitstellung von Warmwasser. Rund 40 % dieses Wärmebedarfs kann durch den Betrieb der Brennstoff zelle abgedeckt werden. Durch die chemische Reaktion wird eine sauerstoff reduzierte Abluft erzeugt. Diese wird zur Unterstützung des Brandschutzes in den Serverräumen weiterverwendet, um eine Art von Schutzatmosphäre zu schaff en. Drei Gaskessel mit je 510 kW sichern den darüberhinausgehenden Heizund Trinkwarmwasserbedarf.
Adaptive Technologielösung für anspruchsvolle Einsatzfelder
Thermische Multivalenzsysteme dieser Art weisen im Betrieb eine wesentlich höhere Komplexität auf als mono- oder bivalente Versorgungslösungen. Sie erfordern ein Umsetzungskonzept, das einerseits eine maximal effiziente Komplementär-Nutzung der verfügbaren konventionellen und regenerativen Energiequellen ermöglicht. Andererseits muss die Anlage eine stabile Wärmeverteilung in der weitläufigen Gebäudestruktur mit einer Vielzahl heterogener Abnehmer gewährleisten. Insbesondere bei der Einbindung von Erzeugern unterschiedlicher Art (fossil/regenerativ) und Leistungsklassen sollen sich konventionelle Speicher- und Verteillösungen häufig als störanfällig erweisen, sodass eine effiziente Nutzung speziell von Niedertemperaturen nicht realisiert werden kann. Auf das noch immer verbreitete Problem einer unzureichenden Systemhydraulik entwickelte das Gebäudetechnik-Unternehmen Zortea aus Österreich mit seiner „Zortström“-Technologie bereits vor Jahrzehnten eine energietechnologische Antwort.
Ein über die Jahre kontinuierlich weiter differenziertes, adaptives Engineering ermöglicht heute den Zortström-Einsatz unter ganz neuen Bedingungen in der thermischen Gebäudebewirtschaftung, wie etwa die des Versorgungsausbaus mit multiplen erneuerbaren Energiequellen. Das Grundprinzip der Zortström-Technologie ist dabei jedoch stets identisch geblieben. Um ein hydraulisch sauberes, bedarfspräzises Vorhalten und Abführen von unterschiedlichen Temperaturen sowohl an die Erzeuger- als auch an die Verbraucherseite zu gewährleisten, kombiniert eine Zortström-Anlage drei grundlegende Funktionen: die komplette Entkopplung aller integrierten Heiz- und Kühlkreise, das Speichern beliebig vieler, exakt voneinander getrennten Temperaturstufen sowie die stabile Ansteuerung der Erzeuger mit den jeweils benötigten Arbeitstemperaturen und die punktgenaue Versorgung der Abnehmer gemäß situativer Abfrage bzw. Vordefinition.
Die exakte Trennung der Temperaturschichten hat einen signifikanten Einfluss auf den Effizienzgrad des Speichersystems. Eine Durchmischung im Speicher mit durchgängig warmem Wasser bzw. mittlerer Temperatur schränkt die effektiv nutzbare Wärmemenge ein: Ist die Speicherschichtung nicht ausreichend stabil, müssen die integrierten Erzeuger mit zusätzlichem Energieaufwand höhere Temperaturen für die Speicherbeladung bereitstellen.
Eine Temperaturschichtung in Wasserspeichern findet auf Grundlage der Schwerkraft sowie der temperaturabhängigen Dichte von Wasser zunächst automatisch statt. Diese „natürliche“ Schichtung wird unter anderem durch Wärmeleitung und Diffusionen im Wasser, mitreißende Strömungen und Bewegungsenergien bei der direkten Speicherbeladung zerstört, wenn das Trägermedium (mit hoher Geschwindigkeit) einfließt. In der Folge wird die Temperatur im unteren Speicherbereich angehoben und sinkt im oberen (eigentlich heißen) Bereich ab.
Die ideale Temperaturverteilung innerhalb des Zortströms wird durch die präzise Wasserzufuhr in die jeweils entsprechende Temperaturstufe erzielt. Die Trennung der Temperaturschichten kann auch dann aufrechterhalten werden, wenn das Wasser mit hoher Geschwindigkeit einfließt. Patentierte FlowSplit-Einheiten sorgen dafür, dass der Wasseraustausch zwischen den Stufen strömungsarm verläuft. Sie garantieren eine exakte Schichtung in den einzelnen Temperaturstufen und ermöglichen gleichzeitig ein bei Bedarf druckloses Überströmen zwischen den einzelnen Schichten. Die Schichtungsqualität im Zortström ist so hoch, dass Umkehrschichtungen – kalt über warm – ebenfalls möglich sind.
Dieses speziell für den Zortström entwickelte Verfahren der Temperaturtrennung und Vermeidung von Vermischungsprozessen der Temperaturschichten wurde am SPF geprüft und zertifiziert. Der Betriebstest ergab einen Schichtungseffizienzgrad von 83,5 %, was der der Effizienzklasse A entspricht. Im Energieprojekt der varisano Klinik Frankfurt Höchst ermöglichen exakte Schichtungstemperaturen eine einfache und genaue Ansteuerung der Energiezufuhr durch Brennstoffzelle und Brennwertkessel und eine präzise Versorgung der Verbraucherkreise. Gleichzeitig kann durch den stufenweisen Temperaturabbau eine besonders niedrige Rücklauftemperatur erzielt und der Brennwerteffekt maximal ausgenutzt werden. Bei Vorlauftemperaturen von 80 °C Warmwasser/60 °C Gebäudeheizung lässt sich so eine Rücklauftemperatur von rund 30-35 °C erreichen.
Das Verfahren der hydraulischen Entkopplung ermöglicht zudem Pumpenstromeinsparungen zwischen 60-90 % gegenüber konventionellen Stangenverteilern. Allein durch die hydraulisch optimierte Versorgung der Verbraucherkreise kann bereits eine Primärenergieeinsparung gegenüber klassischen Systemen von rund 10 % erzielt werden.
Sicherheit, Effizienz und Komfort als Grundpfeiler
Im Mittelpunkt des individuell für die varisano Klinik entworfenen Hydraulik-Konzepts stand die maximal effiziente Primärenergienutzung unter sicheren, störungsfreien Betriebsbedingungen. Für die thermische Versorgung planten die Brendel Ingenieure AG und Zortea insgesamt 9 „Zortström“-Heizanlagen sowie 9 „Zortström“-Kühlanlagen mit einer Gesamtleistung von 3,5 MW (Heizung und Kühlung). Hydraulisch koordiniert werden die Erzeuger-/Verbraucherkreisläufe durch die Ausführungen „Zortström Multi-K“ mit 2 bis 4 Temperaturstufen und „Zortström Multi-H“ mit 3 bis 4 Temperaturstufen. Die Heizanlagen weisen einen Durchmesser von 400 mm bei einem Inhalt von 87 l auf bis hin zu einem Durchmesser von 1200 mm mit einem Inhalt von 2860 l. Die Kühlanlagen haben Durchmesser zwischen 790 und 1500 mm bei Fassungsvermögen zwischen 660 und 3400 l.
Nach einem vorangegangenen Probelauf sind die Anlagen seit Spätherbst 2022 erfolgreich in Betrieb. Sie erzielen heute laut Dokumentation die prognostizierte Pumpenstromeinsparung zwischen 70 bis 90 %, ermöglichen eine maximale Brennwertnutzung und erzielen einen besonders hohen EER (Energy Efficiency Ratio: Verhältnis zwischen Leistungsaufnahme und abgegebener Kälteleistung) der integrierten Kältemaschinen. „Die exakte Schichtung in den ‚Zortström‘-Zentren sowie der stufenweise Temperaturabbau und die hydraulische Entkopplung ermöglichten eine einfache und vollautomatische Umsetzung ohne weiteres Nachjustieren“, so die Projektbeteiligten. Die Anlage laufe strömungsgeräuschfrei und ohne wechselseitigen Hochschaukel-Eff ekt der Pumpen.
Damit erzielt sie die im Klinikbetrieb gewünschte Komfortqualität.
Eine signifikante Effizienzsteigerung verzeichnet die „Zortström“-Integration auch bei der Kälteerzeugung: „Die Prozesse der vollkommenen hydraulischen Entkopplung und die exakte Temperaturvorhaltung ermöglichen es, dass die Verdampfer der Kältemaschinen gleichmäßig und temperaturstabil angeströmt werden und die Erzeuger mit einem maximalen EER arbeiten können“, heißt es von den Anlagenplanern. Positiv auf den Effizienzgrad wirke sich auch die optimierte Volumenstromführung aus: „Verschiedene Abnehmer können in einem Stufenverfahren mit demselben Kühlwasser thermisch versorgt werden. So lässt sich die Energie von Rückläufen effizient als Vorlauft emperatur für den nächsten, in der Temperatur höher ausgelegten Kühlkreis, nutzen.“ Durch die Wiederverwendung des Rücklaufs eines höher temperierten Heizkreises als Vorlauf für einen Niedertemperaturheizkreis kann der transportierte Massenstrom aus der Heizzentrale bei gleicher Energieübertragung teilweise halbiert werden.
Fazit
Um Mensch und Umwelt zukünft ig in einer gesunden Balance zu halten, bedarf es hocheffizienter, klimafreundlicher Energietechnologien. Diese sind bereits heute in einem breiten Spektrum und auf einem hohen Entwicklungsstand verfügbar. Mit Blick auf ihre sozio-ökologische Verantwortung sind Gesundheitseirichtung besonders gefordert, „Clean-Tech“-Optionen in allen Segmenten ihrer Standortführung zu prüfen, energieeffizientes Bauen zu fördern, den Einsatz Erneuerbarer Energien zu erhöhen und Maßnahmen zur Energieeinsparung auf Basis eines professionell verankerten Energiemanagements umzusetzen. Dabei hat die Qualität der Anlagenhydraulik einen zentralen Einfluss auf die reale Effizienz eines energetischen Versorgungssystems. Sie gilt als entscheidendes Kriterium für einen optimierten Betrieb von Multivalenzlösungen.
Das Klinikum im Detail
Die zum varisano Gesundheitsverbund gehörende Klinik in Frankfurt Höchst ist ein Maximalversorgerkrankenhaus, das eine Vielzahl medizinischer Dienstleistungen und Behandlungen in verschiedenen Fachbereichen anbietet. Allein der 2023 fertiggestellte Neubau bietet Platz für 675 Betten (darunter 61 Intensiv- und Überwachungsbetten) und 40 tagesklinische Plätze. Rund 1600 Personen von insgesamt über 2300 Mitarbeitenden sind in den Bereichen Medizin, Pflege und Administration beschäftigt. Der Gebäudekomplex mit sechs oberirdischen Stockwerken weist eine Bruttogeschossfläche von rund 79.000 m2 und eine Nutzfläche von etwa 34.450 m2 auf. Er bietet Raum für insgesamt zehn Operationssäle sowie einen Hybrid-OP.