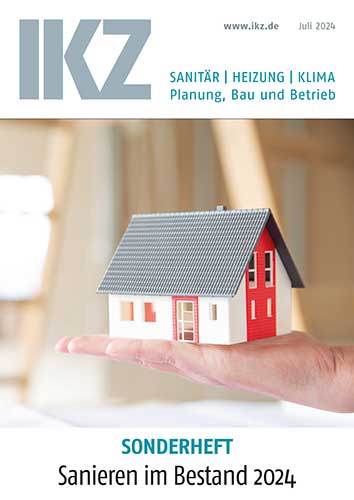Fachpresse: Inhalte auswerten
Über den Nutzen gedruckter Branchenmedien
Wissen, was die Branche beschäftigt: Handwerker sind auf Onlineportalen und lassen sich auf Social Media von Kollegen oder Influencern inspirieren. Aber wenn es um das Geschäft geht, um technische oder wirtschaftliche Themen, die oft rechtlich relevant sind, bleiben Fachpublikationen die Informationsquelle der Wahl. Ob gedrucktes Heft oder online, sie werden auf für das Unternehmen relevante Aussagen hin durchgesehen. Dieses Lesen erfolgt gezielt, es nutzt Strategien.
Durch die Lektüre eines Fachartikels gewinnt der Leser Ideen für den beruflichen Alltag. Die Lektüre der Fachpresse umfasst Informationen über Produkt-Neuheiten, technische Entwicklungen, Branchen-Infos, über Firmen, Seminartermine oder Veranstaltungen. Vieles hat einen langfristigen Informationswert. Bestimmte Artikel sollten nicht nur vom Chef gelesen werden.
Immer im „BILDe“
Im schlimmsten Fall werden Fachzeitschriften erst mal gestapelt und dann nach einiger Zeit entsorgt. Oberflächliches Durchblättern, meist aus Zeitnot, bringt wenig Nutzen für Leser. Optimal ist es, feste Lesezeiten zu planen, möglichst nicht am Arbeitsplatz zu Stoßzeiten, um Unterbrechungen zu vermeiden.
Fachartikel beginnen meist mit dem Teaser, auch als „Aufmerksamkeitserreger“ bezeichnet. In der Einleitung kommt es zur Problembeschreibung, zum Ist-Zustand. Im Hauptteil wird der Lösungsweg präsentiert, mit dem Aufwand und den Vorteilen. Im Schlussteil folgt der Ausblick auf die Zukunft und die Zusammenfassung (Key Notes). Kurz ausgedrückt, geht es immer um die Module BILD: B= Bedeutung des Themas, I= Istzustand, L= Lösungen und Alternativen, D= Darstellung an Beispielen aus der Branche. Autoren in der Fachzeitschrift sind häufig Experten aus der Praxis.
Digital? Print?
Auch wenn schon das Ende der Printmedien postuliert wurde, sind diese noch sehr aktuell. Durch analoge Fachzeitschriften hat der Leser „etwas in der Hand“. Infos auf Papier werden durch die haptische Erfahrung besser im Gedächtnis des Lesers verankert. Inhalte auf Papier wirken zudem vertrauenswürdiger. Sie können nicht so leicht geändert werden wie Infos in digitaler Form.
Print-Beiträge haben meist eine längere Lebensdauer. Online wird anders gelesen und aufgenommen als mit dem Heft in der Hand. Andererseits bietet es den Vorteil der Volltextsuche, was es deutlich vereinfacht, Informationen (wieder) zu finden. Fachverlage bieten längst beides an: Print und Digital, Heft und Onlineauftritt. Mit Publishing-Tools wie YUMPU können gedruckte Zeitschriften so digitalisiert werden, dass man am Bildschirm darin „blättern“ kann und die Optik der gestalteten Seiten erhalten bleibt.
Fachzeitschriften haben einen engen Bezug zum aktuellen Branchengeschehen mit hoher Priorität. Sie haben den Bedeutungswert der „Muss-Informationen“. Manche Ausgaben erscheinen zu Schwerpunktthemen. Beiträge befassen sich mit Hintergrundinformationen, stellen geänderte Normen und gesetzliche Regelun-gen dar, präsentieren Produktneuheiten oder sind Erfahrungsberichte von Anwen-dern mit hohem praktischem Wert. Einen großen Nutzwert bieten nicht zuletzt die Werbeanzeigen oder Fachbeiträge seitens der Hersteller.
Die Fachzeitschrift sollte im Betrieb gezielt in Umlauf gebracht werden, sodass auch Einzelne im Team aktuell informiert sind. Für Mitarbeitende mit Qualifikation gehört die Lektüre zur täglichen Arbeitszeit. Fachberichte gehören in die Hand der entsprechenden Zielgruppe im Betrieb.
Aktiv lesen
Um das Lesepensum in den Griff zu kriegen, braucht es ein wenig Systematik. Beim „Aktiven Lesen“ werden wichtige Textstellen sofort beim ersten Lesen durch Markierungen oder handschriftliche Randbemerkungen hervorgehoben. Dazu verwendet man die bekannten Markierungen: Ausrufezeichen für „wichtig“, Haken für „einverstanden“, Fragezeichen für „noch zu klären“. Einen Bearbeitungstermin kennzeichnet man durch die Datumsangabe und setzt damit Prioritäten. Markierungen helfen, den Text schon für das zweite, spätere Lesen vorzubereiten. Vom Arbeitgeber markierte Textstellen helfen dem Mitarbeiter, wichtige Informationen im Bedarfsfall schnell zu finden. Beim späteren Lesen sind die visuellen Hervorhebungen eine optimale Erinnerungshilfe und führen zur „selektiven Aufnahme“ der Informationen.
Informationen und ihr Wert
Der Wert von Informationen aus der Fachpresse wird in drei Stufen unterteilt: „Muss-Informationen“ gefährden bei Nichterhalt die Qualität des Arbeitsergebnisses oder erhöhen das Risiko. „Kann-Informationen“ sind Informationen, die aktuell noch nicht große Priorität haben. Das Fehlen einer Kann-Information muss sich nicht nachteilig bei der täglichen Arbeit auswirken. „Plus-Informationen“: Sie erweitern eine Information durch Kommentare. Sie sind für wissbegierige Mitarbeitende geeignet, die den Hintergrund einer Information erfahren möchten. Nicht jeder will bis ins kleinste Detail informiert werden.
Schon während des Lesens überlegt der Arbeitgeber, welche Beiträge an Mitarbeiter weitergegeben werden. Vom Overkill spricht man, wenn zu viele Informationen und Details zu einer Belastung werden und Verwirrung schaffen. Informationen, ob schriftlich oder mündlich, müssen so verständlich weitergegeben werden, dass es bei Mitarbeitern nicht zu Missverständnissen oder Rückfragen kommt.
Das Lese-Tempo
Je größer der Leserückstand, desto schneller liest man, um mit der vielen Lektüre fertig zu werden. Es ist wie beim Autofahren, wo man nach einem Stau am liebsten an Tempo zulegt, um verlorene Zeit gut zu machen. Eine hohe Lesegeschwindigkeit („Speed Reading“) führt zur oberflächlichen Aufnahme des Textes, so dass man ihn zwei Mal lesen muss. Schnell-Leser sparen Zeit, überlesen aber Textstellen und bewerten Informationen nicht richtig. Je wichtiger der Text ist, desto geringer sollte das Lesetempo sein. Das Wort-für-Wort-Lesen einer Zeile entspricht der Schrittgeschwindigkeit beim Autofahren. Durch kurzes Nachdenken über den Text kann man die optimale Entscheidung treffen über die Bedeutung der Lektüre. Stress, mangelnde Konzentration und Ablenkung blockieren den Arbeitsvorgang „Lesen“ erheblich und verhindern die Verankerung des Gelesenen im Gehirn. Rationell Lesen bedeutet nicht, möglichst viel in kurzer Zeit zu lesen, sondern das individuelle Lese-Tempo zu finden, um den Lesestoff optimal zu verarbeiten.
Primär kommt es auf Leseziele an. Wozu liest man? Um sich allgemein zu informieren? Oder um eine Entscheidung zu treffen? Oder ist das Thema besonders wichtig? Ist es wichtig und/oder eilig? Welche Relevanz hat die Information für andere im Betrieb? Entscheiden sollte man nach den Leseprioritäten, nicht nach der Lieblingslektüre.
Lektüre priorisieren
Schon beim ersten Lesen sollte man bei Print oder Online nach Prioritäten vorgehen. Das eignet sich das dreistufige System. A-Prio heißt, der Fall ist eilig und wichtig, muss sofort bearbeitet werden, B-Prio heißt, die Sache ist zwar wichtig, aber nicht eilig. Sie wird dann gleich in den Kalender übertragen. C-Prio bedeutet, sie ist weder wichtig noch eilig und kann unter „Allgemeines“ gespeichert werden. Mit der Zeit wird die C-Prio bei B oder A landen. Das Ablagesystem nach Prioritäten ist eine wesentliche Entlastung. Die einfachste Ablage ist das ABC-System, das aber keine Aussage über die Dringlichkeit macht. Nicht alles muss sofort bearbeitet werden, auch die Geschäftspartner nehmen nicht sofort eine Bearbeitung vor.
Was nicht sofort gelesen werden muss, wird auf Termin gelegt. Auf Dauer kann ein großer Leserückstand aber belastend sein und muss deshalb rechtzeitig in „stiller Stunde“ abgearbeitet werden. Rückstände müssen möglichst überschaubar sein. Lektüre, die nicht viel Zeit benötigt, wird sofort verarbeitet.
Check: „Informationsmanagement“ beim Lesen
Wer gezielt liest, hat mehr von den Inhalten:
Leseziele
- Wissen aneignen
- Meinung bilden
- Entscheidungen treffen
Informationswert
- Muss-Informationen
- Kann-Informationen
- Plus-Informationen
Leseverhalten
- Feste Lesezeiten
- Lesetempo finden
- Lese-Bremsen vermeiden
Textverarbeitung
- Textstellen markieren
- Randnotizen vornehmen
- Ablage für späteres Nachsehen
- Lektüre bewerten
Viele Brancheninformationen holt man sich aus dem Netz. Aber man verliert jede Menge Zeit, wenn man nicht aufpasst. Am besten also die Uhr auf den Tisch und nicht auf jeden Link klicken. Gerade, weil Recherchieren im Internet einfach ist, wird es immer wieder genutzt, ohne auf den Zeitaufwand zu achten. Braucht man jede Information? Welchen Zeitwert hat sie? Was passiert, wenn man Google & Co. mal einschränkt? So wichtig Informationen sind, man muss sich der Flut durch Enthaltsamkeit erwehren.
Das ist auch ein Vorteil der Fachzeitschrift: Man kann sie jederzeit zur Seite legen und später weiterlesen.
Autor: Dipl. Betriebswirt Rolf Leicher